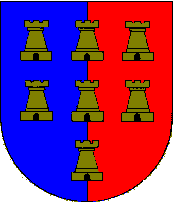
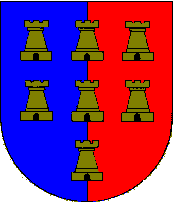
Bildergalerie
Waldhüttener Bräuche und Sitten mit Bilder
Waldhüttener Geschichte
Verschiedene Geschichten, Gedichte und Bilder aus der Heimat aus Familienalben
Der Vorstand lädt alle Waldhüttner, Freunde und Bekannte zu unserem Treffen herzlich ein.
Damit die Planung gut vorbereitet werden kann, bitten wir um Anmeldung
bis Ende August 2024 bei folgenden Vorstandsmitgliedern:
Anna Knall 0911.73 92 91 Hans Schobel 0170.40 23 256
Es würde uns freuen, wenn zum Gottesdienst und zum kulturellen Programm viele Waldhüttner in Festtracht oder im Dirndl kommen würden. Wir hoffen, dass zahlreiche Waldhüttner teilnehmen werden und freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein und auf eine gute Unterhaltung.
Und nun zum Ablauf:
Saalöffnung ist um 10 Uhr im Gasthaus „Zum Falkenheim“. Wir starten mit dem Gottesdienst um 11 Uhr mit Pfarrer Tobias Wölfel, begleitet an der Orgel von Wolli und Gesang von Jürgen aus Siebenbürgen. Anschließend Mittagessen nach kleiner Menü-Karte. Für das Kuchenbuffet wird gebeten, nach Möglichkeit, einen Kuchen oder eine Torte mitzubringen. Der offizielle Teil erfolgt durch die Begrüßung vom Vorstandsvorsitzenden, Hans Schobel. Es folgt das kulturelle Programm mit Volkstanz und Singen. Ab 18 Uhr spielt unser Musikant „Fred am Keyboard“ und sorgt für gute Stimmung.
Das Waldhüttner Heimatblatt wird zum Treffen erstellt, dazu benötigen wir Eure Berichte und Anzeigen. Bitte übersendet uns Eure Familienereignisse (Konfirmationen, runde Geburtstage, Hochzeiten, Geburten, Taufen oder sonstige Ereignisse) bis Ende Juli 2024 per
E-Mail an: Annerose.binder@web.de oder WhatsApp: 0171.9504930
Euer Vorstand
Veranstaltungsort:
Gasthaus „Zum Falkenheim“
Germersheimer Straße 86
90469 Nürnberg
Übernachtungsmöglichkeiten:
Novotel Nürnberg IBIS Palmengarten
Münchener Str. 340 Ulmenstraße 52B Donaustraße 25
90471 Nürnberg 90443 Nürnberg 90451 Nürnberg
Tel. 0911.81260 Tel. 0911.94175820 Tel. 0176.10392555
Geplante Termine 2024
19. Mai 2024 Sachsentreffen in Dinkelsbühl
Wir freuen uns sehr, wenn zum Trachtenumzug viele Teilnehmer kommen, gerne auch die junge Generation. Nach dem Umzug treffen wir uns zum gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Zum Stern, Dr.-Martin-Luther-Str. 18, 91550 Dinkelsbühl.
Es besteht auch die Möglichkeit, vor dem Umzug sich dort umzuziehen und gemeinsam von dort zum Umzug zu gehen.
2. bis 4. August 2024 Großes Sachsentreffen in Herrmannstadt
Wir möchten hiermit einen Aufruf zur Mitwirkung am Heimattag in Dinkelsbühl, sowie am großen Sachsentreffen in Hermannstadt, starten.
7. August 2024 Kirchen- und Friedhofspflege in Waldhütten
Wer vor Ort ist, kann sich gerne an der Kirchen- und Friedhofspflege beteiligen.
Unter dem Motto „Gemeinschaft – mach mit!“ freuen wir uns auf das Wiedersehen und hoffen, dass viele von Euch den Weg nach Nürnberg finden.
Hinweis:
Luis Binder und Manuel Benning werden für die junge Generation eine WhatsApp Gruppe einrichten, damit auch hier der Kontakt der jungen Waldhüttner gepflegt werden kann und Informationen ausgetauscht werden können. Wer in die Gruppe aufgenommen werden möchte, bitte die Handy-Nr. an Luis 0175.1195505 oder Manuel 0172.6444129 schicken.
Liebe Waldhüttner!
Es ist jedes Jahr eine große Freude zu sehen, welche Verbundenheit und Zusammenhalt bei den Waldhüttnern besteht. Es zeigt uns immer wieder, wie stark die Gemeinschaft der Waldhüttner und die Verbindung zu den anderen Nachbargemeinden ist. Wir möchten hiermit die Erinnerung der Ereignisse dieses Jahres nochmal aufleben lassen.
Beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl waren wir in diesem Jahr besonders stark vertreten, aufgrund der hohen Teilnehmerzahl. Es ist sehr erfreulich, dass auch die jüngere Generation und immer mehr Waldhüttner und Freunde sich der Trachtengruppe anschließen.
Der Höhepunkt in diesem Jahr war unser 2. Heimattreffen in Waldhütten. Es waren ergreifende Erlebnisse, sich bei Hunklich und Pali im Kirchhof wiederzusehen und freudig zu begrüßen. Der Klang der Heimatglocken lud zum Gottesdienst mit Abendmahl ein. Herr Dr. Pfarrer Fröhlich begrüßte alle von Nah und Fern. Katharina (Trinni) Schuller trug unter Emotionen ihr selbst geschriebenes Gedicht vor. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von der Blaskapelle „Die Bartscher“. Nach dem Gottesdienst gingen wir gemeinsam in den neu renovierten Saal zum Mittagessen.
Anschließend folgten die Grußworte durch den Vorstandsvorsitzenden Hans Schobel und dem Bürgermeister Nicu Lazar aus Halvelagen. Der kulturelle Teil begann mit dem Aufmarsch vom Kirchhof zum Schuilhäfel. Dort wurde das Waldhüttner Lied, gedichtet von Pfarrer Ungar, das Siebenbürgerlied, sowie andere siebenbürgische Lieder gesungen. Auf dem Lindenplatz wurde bis zum späten Nachmittag getanzt. Für Tanzmusik sorgten abwechselnd die Blaskapelle „Die Bartscher“ und unser langjähriger Musikbegleiter „Fred am Keyboard“.
Ein großes Lob und Dankeschön an die Jugend, die uns tatkräftig unterstütze und die Getränkeausgabe übernahm.
Am Sonntag ging man zum Friedhof, jeder besuchte das Grab seiner Großeltern, Eltern, Onkel, Tanten und nahm nochmal Abschied.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, die den weiten Weg auf sich genommen haben, für die Spenden und die fleißigen Hände, ohne die das Treffen nicht so gelungen wäre.

Südlich der Großen Kokel, im Tale eines Nebenflüßchens, liegt Waldhütten, das sein erstes Auftauchen in geschichtlichen Quellen einem wenig rühmlichen Vorfall verdankt der Plünderung der kleinen Nachbarorte Rauthal und Neudorf durch sächsische Grafen von Kirtsch u. a. Gemeinden. 1345 verhörte man die Bauern von Waldhütten im nachfolgenden Prozess. Am 21. Dezember 1390 stellte Papst Bonifacius IX. einen Ablaßbrief für "die Pfarrkirche des Apostel Andreas in Valtudia Transsylvaniensis diocesis" aus, der wohl mit dem Bau der spätgotischen, turmlosen Saalkirche in Zusammenhang gebracht werden kann. Das außen unter der Traufe an der Südchorwand in den Mörtelputz geritzte Datum 1507 bezieht sich mutmaßlich auf die Einwölbung des Chores, dessen Stichkappentonnengewölbe mit einem sehr ähnlichen Rautennetz aus Tonrippen überzogen ist wie der 1504 vollendete Baaßner Chor. Der schmale, langgestreckte, von zweifach abgetreppten Strebepfeilern dicht umstandene Bau, mit seinem steilen, hohen Satteldach über Chor und Saal, wirkt durch seine wohlausgewogenen Proportionen und die rhythmische Vertikalgliederung der Südfront als Schauseite der Kirche überaus harmonisch, wie ein ins Riesenhafte vergrößerter gotischer Reliquienschrein. Zehn Strebepfeiler stützen die weißgekalkten Saalwände, fünf die Chorecken; zwischen zwei Strebepfeilern der Nordchrowand ist eine Sakristei eingebaut, die von zwei Jochen eines Tonrippengewölbes überführt war, von dem sich jedoch nur Ansätze erhalten haben. Es fiel dem Erdbeben von 1916 zum Opfer und wurde durch eine einfache Bretterdecke ersetzt. Im 19. Jh. trat an Stelle der alten Kassettendecke - wie sie an vielen Kirchen dieser Gegend üblich war - ein barockes Tonnengewölbe mit Stuckornamenten, von Gurtbögen in vier Felder geteilt und von fünf Wandpfeilerpaaren mit klassizistischen Gesimsen getragen, die den Saalwänden angeblendet wurden, aber den Strebepfeilern der Außenmauern nicht entsprechen. Gleichzeitig vergrößerte man die Spitzbogenfenster der Südsaalwand, wobei altes Maßwerk entfernt wurde - die Nordwand ist völlig lichtlos. Nur im Westgiebel des Saales und in der Ostwand des Chorschlusses haben sich zwei alte schöne Fenster erhalten, mit Vierpaßdurchbruch über Kleeblattbögen. Im 19. Jh. errichtete man auch im Westende des Saales die Empore mit Sitzplätzen für die männliche Jugend - die Knechte -, sie trägt an der Brüstung das Datum 1922 in Mörtelputz ausgeführt, das sich wohl auf eine Restaurierung bezieht. Die Nordsaalwand entlanggeführt ist eine Empore, die auf flachen, zwischen den Pilastern eingespannten Ziegelarkaden ruht, ihre Holzbalustrade trägt das Datum 1871, aufgemalt. In der schmalen, spitzgiebligen, rauchgeschwärzten Westfront öffnet sich das Hauptportal mit feingemeißelter Steineinfassung, deren vollendete Eleganz und schwungvolle Linienführung uns sehr bekannt anmutet: ein hochgezogener, in einer Kreuzblume auslaufender Kielbogen, zwischen zwei schlanken Fialen - das Dekorationsschema des Westportals (1448) der Hermanstädter Stadtpfarrkirche! Allerdings - am Waldhüttner Portal kreuzen sich die runden Profilstäbe des Gewändes im Bogenscheitel, während sie sich in Hermannstadt zum einfachen Spitzbogen schließen. Unter dem Scheitelpunkt hängt ein steinernes Wappenschild mit einem Steinmetzzeichen (wie manche Forscher annehmen) - wir erkennen darin die Jahreszahl 1441 in ornamentaler Schreibweise, wissen wir doch, daß der gotische Vierer wie ein halber Achter aussah. Ein Meisterzeichen durfte nicht so augenfällig, ja pretentiös angebracht werden ! Die Beziehung zur Hermannstädter Bauhütte aus der Mitte des 15. Jh. wird an manchen Monumenten der nächsten Umgebung offenbar: Reichesdorf, Meschen, Hetzeldorf, wo der berühmte Hermannstädter Steinmetz Andreas Lapicida nachweislich gearbeitet hat. Überraschend wirkt der anmutige Schwung, der harmonische Fluß der Lichter und Schatten zwischen dem zarten Stabwerk dieses Türrahmens, da er so unerwartet auf der mächtigen, eintönig grauschwarzen Steinfläche der Westfront hervortritt, rings nur vom rohen rotbraunen Sandsteinmauerwerk der Wehrbauten umgeben. Dem später gebrochenen Südportal - ein simpler Rechteckeingang - ist ein kleiner Portikus vorgebaut, der ein Kreuzgewölbe und ein Satteldach darüber trägt. Der Nordeingang ist zugemauert. Da in dieser Kirche - wie vielerorts in der Schäßburger und Repser Gegend - die Orgel im Osten über den. Altar gesetzt ist, wurde dafür noch ein breiter, flacher Stützbogen eingebaut. Die Orgelempore ist über ein zwischen die beiden SO-Pfeiler des Chores eingebautes Treppchen zu erreichen, das auch ein schmales Schutzdächlein erhalten hat. Zum Unterschied von den meisten Kirchen der Kokelgegend ist die Waldhüttner Saalkirche nicht wehrbar gemacht worden - die schützenden Mauern ihrer Kirchenburg machten diese Vorkehrung unnötig, da sie 10 m hoch aufragten und den Kultbau in engem, nahezu regelmäßigem Rechteck umstellen. Zu Beginn des 16. Jh. entstand der einfache, ganz aus rotbraunem und graugelbem Sandstein errichtete Wehrring, dessen perfekt rechteckige Form nur im SW-Eck eine Einziehung erfuhr, um sich dem Lauf des Wassergrabens anzupassen - heute ein bescheidenes Bächlein, ehemals ein beachtliches Hindernis vor dem Feind. Während an anderen Burgen mit ebenerdiger Lage inmitten des Dorfes die Wehrtürme meist die Mauerecken verstärken, stehen sie hier ausnahmsweise im Zentrum der vier Seiten, vor die Mauer vorspringend und bloß 20 cm in den Burghof hineinragend - da der die Wehrmauer innen umgebende Wehrgang auch an den Fronten , der Türme entlanggeführt war. Der Südturm stürzte beim Erdbeben von 1916 ein, sein Standort ist an den nach innen vorspringenden Mauerresten kenntlich. Mit Ausnahme des Westturmes sind die Erdgeschosse gewölbt, die oberen Stockwerke durch Balkenplattformen getrennt - ursprünglich gab es nur einen Einstieg in die Türme, vom Wehrgang aus in das zweite Geschoß. Nur der Südturm besaß einen Gußschartenkranz an der Basis des Obergeschosses, alle anderen Türme sind ausschließlich mit Schießscharten bewehrt - den schmalen, hohen Schießschlitzen entsprechen im Innern höhe, stark ausgeweitete Nischen, in denen die Schützen aufrecht stehen und die Geschütze bequem nach allen Seiten wenden konnten. Der mächtige Ostturm an der Straßenfront wacht über die Toreinfahrt. Zwischen zwei starken Bögen, die die 2,5 m dicken Seitenmauern verbinden, spannt sich ein Kreuzgewölbe. Der Einstieg zu den Wehrgeschössen erfolgt heute durch einen seitlichen Aufgang durch die Ringmauer. Ungeheure Steinmassen sind zum Bau dieser Burg herbeigefahren worden. Sicher stammen sie aus dem "Lapesch" (Lapus) genannten Tal, um das die Nachbargemeinden, Großkopisch, Malmkrog, Neudorf, mehrere Jahrhunderte stritten, und das bald der einen, bald der anderen zugesprochen oder zwischen ihnen geteilt wurde, jedenfalls brachte man dorther für alle Monumentalbauten der Umgebung den rotbraunen Sandstein. Im Gegensatz zum sechsgeschossigen Ostturm, den ein holzverschalter Wehrgang krönt sind Nord- und Westturm nur fünfgeschossig. Das kleine Türmchen über dem Fußgängereingang im SW steht unmittelbar vor dem Bach. Über dem gewölbten Durchlaß ist in seiner Westwand immer noch die "feste Rolle" angebracht, über die das Seil lief das die vor den Turm über den Bach gelegte Brücke hochzog und vor dem Eingang aufstellte. Eine vorgekragte Pechnase mit Staffelgiebel schützt den tonnengewölbten Eingang. Sinnreich steht unter dem rot und blau bemalten Traufgesimse die Inschrift:
"Gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist enge und der Weg ist schmal, der zum Leben führet. Math. 7.13."
Heute ist der Wehrgang abgetragen - nur die Einsatzlöcher seiner Tragebalken deuten seinen Verlauf an sowie die in 4 m Höhe sich verjüngende und einem schmalen Vorsprung Raum gebende Mauer, der dem Wehrgang als Auflager diente. Die einstig imposante Höhe der Ringmauer ist auch nur noch an den Ansatzspuren in den Turmwänden zu erkennen, das Mauerwerk ist stark ausgebröckelt. Das Nordosteck des Burghofs muß ehemals ein "Lecheguerten", ein Begräbnisplatz, gewesen sein. Gräbt man da nur einen Spatenstich tief, stößt man auf Schädel und Gebeine, die hier wohl in ein Massengrab geworfen wurden. Solche Massengräber innerhalb sächsischer Kirchenburgen lassen meist auf eine Seuche, häufiger noch auf ein Massaker schließen, dem eine größere Menschenmenge zum Opfer fiel. Ein solches mag auch hier im Mai 1605 stattgefunden haben, als während des Bürgerkrieges Truppen des siebenbürgischen Fürsten Stefan Botschkai, eines Gegners des Hauses Habsburg, nicht nur Waldhütten, sondern auch Großkopisch, Reichesdorf, Scharosch niederbrannten und die Kirchenburgen ausplünderten. In dem eng von Hügeln umstandenen Talkessel bietet die Waldhüttner Burg mit den rotbraunen Mauern, den weißgekalkten Kirchenwänden dahinter, mit dem steilen Kirchendach und den elegant geschwungenen Flächen der pyramidenförmigen Turmdächer ein überaus malerisches Bild.

© 2005 bei Hans Christian Fleischer und Hans Schobel